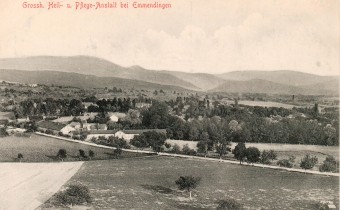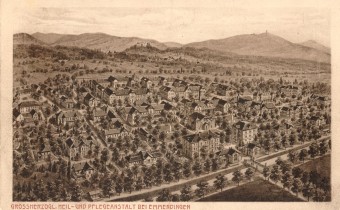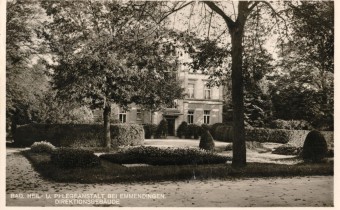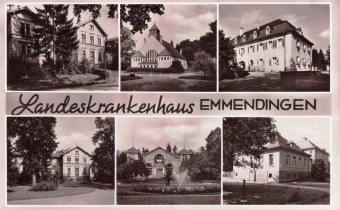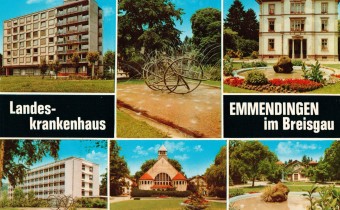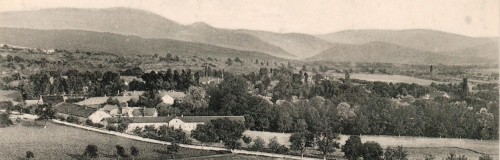
Kontakt
Obere Bergstraße 28
77933 Lahr
Neubronnstraße 25
79312 Emmendingen
Telefon 07641 461-0
Telefax 07641 461-2901
info@zfp-emmendingen.de
Riesstraße 14
79539 Lörrach
Am Alamannenfeld 22
79189 Bad Krozingen
Gartenstraße 44
79312 Emmendingen
Wurmberger Straße 4b
75175 Pforzheim
Bunsenstraße 120
71032
Kartäuserstraße 39
79102 Freiburg
Schwarzwaldstraße 40
79650 Schopfheim
Im Lützenhardter Hof
75365 Calw
Telefon +49 7051 586-0
Telefax +49 7051 586-2700
info@kn-calw.de
Rutesheimer Straße 50
71229 Leonberg
Ludwig-Wolf-Straße 1
75181 Pforzheim
Waldburgstraße 1
71032 Böblingen
Ramiestr. 7
79312, Emmendingen
Telefon Telefon 07641 954070
Telefax Telefax 07641 95407-10
info@haus-tecum.de